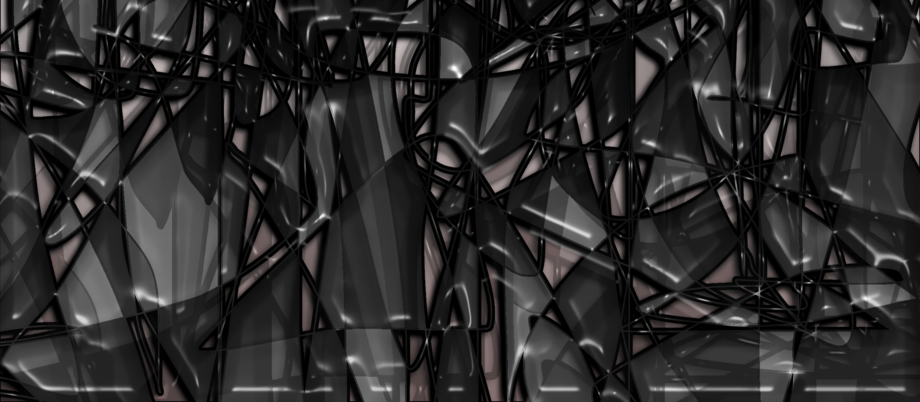Auszug aus dem Roman
Die Ruinen von Vinatur
Jenseits des östlichen Gebirges
Herzog Skarben kniete am großen Teich, den alle nur den Mutterschoß nannten, und rieb seine schrundigen Klauen mit Algen ein, die seine dunkelgrüne Haut noch grüner leuchten ließ.
Die Nacht der Neuen Brut rückte näher, und Skarben hoffte, das der Teich dieses Mal nicht ganz so üppig gebären würde wie vor sieben Jahren.
Ein winziger, blau schimmernder Frosch glitt vor ihm durch das Wasser, die Schwanzflosse der Quappe noch zwischen den Hinterbeinen. Skarben beobachtete ihn mit reglosen Augen. Ein dunkler Schatten huschte unter dem Frosch durch den Teich.
Einer der Hauptmänner seiner Horde trat an ihn heran und verbeugte sich tief.
„Mein Herzog, wir haben einen Gefangenen gemacht, in der Knochenschlucht. Ein merkwürdiger Mann, mit einem Brandmal auf der Rechten, ganz ähnlich dem Siegel der Abgesandten. Vielleicht ein Späher.“
Seine Stimme klang rau und ungeübt. Er war jetzt im dritten Alter und hatte gerade erst richtig zu sprechen gelernt.
Skarben schaute ihn abschätzig an.
„Ich denke nicht, dass Ihr fähig seid, so voreilige Schlüsse zu ziehen.“
Andererseits könnte der Mann recht haben. Den Abgesandten der Maris-Jünger war nicht zu trauen. Sie hatten es zwar bis über das Gebirge geschafft, sie hatten die Erzherzöge sogar um ein Bündnis gebeten. Was sie jedoch genau wollten, war ihnen nicht zu entlocken. Oder aber Skarben stand in der Rangfolge nicht hoch genug, als dass die Erzherzöge es ihm erzählen würden.
Er blinzelte in die bleichen Sonnenstrahlen, die durch die Blätter der Sumpfweiden brachen, an den Schlingpflanzen entlang glitten, den feinen Dunst über dem großen Teich wie einen Silberschleier leuchten ließ.
„Sind die Vorbereitungen für das Fest der Neuen Brut abgeschlossen?“
Der Hauptmann wiegte den bulligen Schädel zögerlich hin und her. Seine Lefzen kräuselten sich und gaben den Blick auf die scharfen Fangzähne frei.
„Sie kommen voran … hat man mir gesagt.“
Skarben schaute wieder auf den Wasserspiegel und konnte jetzt deutlich den Raubfisch erkennen, der unter dem wild paddelnden Frosch kreiste. Er formte seine Klaue zu einer Schale und fischte den Frosch aus dem Wasser. Das Tier zappelte kurz und blieb dann, starr vor Schreck, in seiner Klaue sitzen. Noch vor ein paar Wochen war es eine Kaulquappe gewesen, kaum mehr als eine Pflanze, so wie seine Horde, so wie die Kinder seines Volkes.
Skarben räusperte sich, das Sprechen fiel ihm schwer. Auch nach all den Jahren kamen ihm die Worte an manchen Tagen wie zäher Schleim aus der Kehle.
„Was hat es mit diesem Gefangenen auf sich? Wieso hat er versucht, den Knochenrücken zu queren?“
Der Hauptmann zuckte mit den Schultern.
„Er spricht nicht, mein Herzog.“
„Ah, einer der Unsrigen!“
Aber der Hauptmann verstand den Scherz nicht, schaute nur stumpf in Skarbens Gesicht und wartete auf Anweisungen.
Das Wasser war dunkler als gewöhnlich. Nicht mehr lang bis zur Nacht der Neuen Brut, das konnte Skarben erkennen, der Teich bereitete sich vor, kam in Wallung, als würden die Algen am Grund brodeln und als grüne Wolken zur Oberfläche ziehen.
„Bringt mich zu dem Gefangenen. Wo habt Ihr ihn untergebracht?“
„In den Käfigen bei den Mondsümpfen. Seine Beine sind schon voller Blutegel.“
Der Hauptmann grinste mit schmalen Lippen. Skarben keuchte vor Unwillen.
„Bei der Moormutter! Was habt Ihr Euch gedacht? Ihr wisst genau, dass diese Käfige nicht für die Menschen gemacht sind.“
Langsam erhob sich der Herzog. Der winzige Frosch saß noch immer in seiner Klaue und schien ihn anzustarren, mit glänzenden Augen. Ganz so wie seine Untergebenen, seine kämpfenden Söhne, diese stumme Brut des Teichs.
Skarben schloss die Augen und spürte den leichten Wind auf dem Gesicht. Grillen wisperten im Riedgras, der torfige Geruch des Ufers stieg ihm in die Nase.
Langsam öffnete er wieder die Lider und blickte den Hauptmann voller Verachtung an, dann ballte er seine, von Algen überzogene, Klaue zur Faust und drückte so lange zu, bis ihm das Blut des Froschs zwischen den Knöcheln entlang rann.
1. Ajala
Die Knochenreiter kamen mit dem Morgengrauen. Die Brustkörbe ihrer Feinde trugen sie als Harnische. Helme aus Schädelplatten zierten ihre Köpfe. Ihre Visiere waren aus Fingerknochen gemacht. Feuer und Blut zogen sie wie eine Schleppe durch das Land. Eine Hochzeit des Todes.
Ajala kauerte auf der Hügelkuppe und starrte hinunter ins Dorf, die kleine Ansammlung von Lehmhütten, deren Strohdächer in hellen Flammen standen. Auch das Langhaus brannte, und sie konnte gellende Schreie hören. Ein beißender Geruch von Rauch lag in der Luft.
Leichen bedeckten den Dorfplatz, erschlagen von eisernen Hämmern und bronzenen Äxten.
Über der weiten Steppe dahinter kroch der gespaltene Mond am Horizont entlang, zeigte sein zerklüftetes Gesicht. Ein unheilvolles Zeichen, dass sie seit Monaten nicht mehr gesehen hatte.
Ajala war lang vor Tagesanbruch auf die Jagd gegangen. Allein, denn so erlegte sie das meiste Wild, mehr als die erfahrensten Jäger ihrer Stammes.
Sie mochte es, einsam durch die Berge zu streifen, zwischen den grauen Felsnadeln zu lauern, um dann einen Pfeil aus dem Hinterhalt schwirren zu lassen, der einem Steinbock oder einem Hasen den Leib durchbohrte.
Sie war schon früh zur Jägerin geworden, weil sie schon früh für sich sein wollte, für sich sein musste, fernab von der Gemeinschaft, dem Geschwätz, den Verpflichtungen, den Verehrern, die sie kaum noch wahrnahm, die aber niemals aufgaben. Das Dorf war alles, was sie Heimat nennen konnte, aber sie verabscheute jede einzelne Hütte. Trotzdem schnitt jetzt ein brennender Schmerz durch ihren Leib. Es war ihr Volk, das dort hingeschlachtet wurde, so fern es ihr manchmal auch war.
Seit ihr Bruder Miran verschwunden und ihre Eltern ums Leben gekommen waren, lebte sie am Rand des Dorfs allein in der kleinen Hütte, die einst ihr Großvater gebaut hatte. Dort spähte sie hin. Es war eines der wenigen Gebäude, das noch unversehrt war.
Die Knochenreiter trieben die letzten Überlebenden vor dem brennenden Langhaus am Dorfplatz zusammen, alte Frauen und verängstigte Kinder. Als wären sie trockenes Holz, warfen die Reiter die Alten und Kinder in das Langhaus, das mehr einem Ofen glich, mit den gleißenden Flammenfahnen in gelb und rot. Dann versperrten sie den Eingang.
Ajalas Finger zuckten, unwillkürlich griff sie nach ihrem Bogen, tastete nach dem Köcher. Aber wäre das nicht ein Ritt auf Maris Wagen in die Unterwelt?
Sie konnte es mit diesen Schergen nicht aufnehmen, daran war kaum zu zweifeln. Sie ritten stumm durch die Gassen und spalteten den verbliebenen Männern die Köpfe. Einige taumelten noch ein paar Schritte weiter, während ihr Blut auf die Knochenrüstungen der Reiter spritze und sie tiefrot färbte. Andere krochen durch den Staub, bis ihre Rücken von den Hufen der Schlachtrösser zertreten wurden.
Viel hatte Ajala von den Knochenreitern gehört, vor allem Gerüchte. Und alle Gerüchte hatten den gleichen Inhalt gehabt. Wo die Knochenreiter auch auftauchten, da hinterließen sie nur Leichen, keiner entkam.
Und niemand konnte deshalb die Wahrheit berichten, so dass sich Legenden bildeten. Unzählige Schauermärchen von der überweltlichen Abstammung dieser Krieger, von ihrem Blutdurst, ihrem Schweigen. Nie schienen sie ein Wort zu sagen. Und es ging ein Geruch von ihnen aus, der weit übler stank als jeder Pesthauch, so hörte man sagen, von Leuten, die sie aus weiter Entfernung erspäht hatten.
Ajala hatte Geschichten gehört, von Dörfern nahe der Gipfel des Knochenrückens, die vollständig ausgelöscht worden waren, so dass nicht einmal mehr ihre Namen überdauerten. Ganze Landstriche wurden alle sieben Jahre von den Knochenreitern verheert, erzählte man sich. Doch so weit ins Steppenland, so weit in den Westen war der Feind bisher nie gekommen. Nur seinen Pesthauch konnte man manchmal riechen, wenn der Wind ungünstig stand und über die Ebene peitschte. Das jedenfalls hatte ihr die alte Fareij erzählt, abends am Feuer. Eine Legende aus dem Grünen Buch der Erde, lange vor ihrer Zeit niedergeschrieben, und in den Dörfern von Mund zu Mund weitergegeben.
Ajala konnte hier oben, an der Flanke des Vorgebirges, nichts davon wahrnehmen, nur der Brandgeruch wehte die Hänge hinauf, und kein Ruf war zu vernehmen, während die Knochenreiter auf ihren grauen Pferden zwischen den Hütten entlang preschten und auch die letzten Dächer in Brand setzten.
Dann ritten sie langsam davon, gen Westen, am Fuß des Gebirges entlang, ohne auch nur einen Moment nach Beute zu suchen, als wäre ihnen das Blutbad ausreichend Lohn gewesen.
Sobald sie außer Sicht waren, hastete Ajala den Hügel hinab und auf das Langhaus zu, das in der Mitte des Dorfplatzes stand. Die Flammen züngelten meterhoch in die Luft. Und der diesige Himmel spannte sich über den totenstillen Morgen.
Die schwere Holztür war mit Eisenketten versperrt, und Fensterluken gab es in dem Langhaus nicht, da es nur für die abendlichen Zusammenkünfte gebaut worden war.
Ajala riss am Türgriff, zuckte aber schreiend zurück. Das Metall war glühend heiß, und ihre Handfläche schlug sofort Blasen.
Dumpfe Rufe waren aus dem Inneren zu hören, mehr ein Röcheln und Keuchen, und Ajala war versucht sich die Ohren zuzuhalten, als sie hinter sich ein unmenschliches Kreischen hörte, als würden Schieferplatten aneinander gerieben, oder als würde sich der Himmel öffnen und ein Untier auf sie herabstürzen.
Sie wirbelte herum und sah direkt in seine Richtung. Ein einzelner Knochenreiter, groß und bedrohlich, hoch auf seinem falben Schlachtross, eine bronzene Axt in der rechten Hand.
Hinter dem Visier aus Knochen glaubte sie, seine kalten Augen erkennen zu können. Alle Gedanken wichen aus ihrem Kopf, als der Reiter die Axt hob und zum Sturm ansetzte. Die Schneide blitzte im Schein des Feuers. Wieder stieß der Reiter einen Schrei aus. Gurgelnd, als wäre ihm die Zunge herausgeschnitten.
Ajalas Welt schrumpfte auf diesen einen Punkt zusammen, den sie auch bei der Jagd erreichte, eine Lichtung in der Gedankenwelt, karg und klar, der Blickpunkt des Jägers.
Sie merkte es kaum, wie ihre Finger einen Pfeil griffen und den Bogen spannten. Erst als der Knochenreiter schon fast über ihr war, ließ sie die Sehne los und der Pfeil schnellte durch die Luft, durchbrach den Harnisch, drang tief in das Fleisch ein, genau an der richtigen Stelle.
Der Knochenreiter ließ ein dumpfes Stöhnen hören, blieb aber aufrecht auf seinem Pferd sitzen, hob die Axt zum Schlag.
Ajala beugte sich zurück, sah in die milchigen Wolken und erwartete ihren Tod, als der Reiter langsam den Arm sinken ließ. Die Axt entglitt ihm und fiel in den Staub, lautlos fast.
Dann rutschte die Gestalt langsam zur Seite. Ajala konnte das Reiben der Knochen auf dem Ledersattel hören. Wie in einer Tanzbewegung sackte der Reiter vom Pferd und schlug auf dem Boden auf. Ein letztes Röcheln, dann Stille.
Ajala riss sich aus ihrer Erstarrung und griff nach der Axt, sie war fast so schwer wie ein Amboss. Unter Aufbietung all ihrer Kräfte wirbelte sie die Waffe herum und schlug gegen die Tür des Langhauses. Zwei wuchtige Schläge, drei, dann endlich gab die Tür nach und riss aus den Angeln.
Feuer und Rauch stoben ihr entgegen, sie musste zurückweichen, um nicht von den Flammen gefressen zu werden.
Kraftlos ließ sie die Axt sinken. Hier war niemand mehr zu retten, kein Laut war zu hören. Die Frauen und Kinder des Dorfes waren zu verbranntem Fleisch und Asche geworden.
Ajala brach in die Knie und fand sich am Boden wieder, Tränen rannen über ihr Gesicht, vermischten sich mit der Asche der Frauen und Kinder, dem Staub der Berge, dem Sand der Ebene.
Es kam ihr wie Stunden später vor, als sie sich endlich wieder erhob. Das Langhaus war mittlerweile bis auf die letzten Pfosten niedergebrannt und auch die übrigen Hütten schwelten nur noch. Der Wolkenhimmel lastete tief über dem Land. Und eine Stille war eingetreten, die noch schwerer wog, als die verwehten Schreie der Getöteten. Kein Vogel war zu hören, kein Surren einer Mücke, nur das gleichmäßige Rauschen des Steppengrases drang an ihr Ohr.
Voller Verzweiflung blickte sie zum Himmel und erschauderte. Der gespaltene Mond stand noch immer groß und grünlich über dem Horizont, ein riesiges Auge mit einer geschlitzten Pupille. Dort würde er nun wandern, drei Tage lang zur morgendlichen Dämmerstunde. Gestern noch war am Himmel nur ein schwaches Leuchten gewesen, und obwohl Ajala gewusst hatte, was dort am nächsten Tag zu sehen sein würde, wurde sie immer wieder von diesem Anblick überrascht und verängstigt, wenn der böse Bote über den Horizont kroch. Grünmond, Miasmenmond – ein schlechtes Omen seit Menschengedenken. Zu recht, wie sie jetzt wusste.
Alte Legenden sprachen davon, dass der Mond einst in stillen, geraden Bahnen über den nächtlichen Himmel gezogen sei, aber dann wäre ihm vom Todesboten Harlak das Gesicht zerschnitten worden. Und seither hatte er sich, gezeichnet mit dem tiefen langen Spalt auf seiner Oberfläche, hinter den Horizont zurückgezogen, um nur noch alle zwei Wochen auf die Welt zu scheinen, bleich und aus weiter Ferne, um dann wieder zu verschwinden für zwei weitere Wochen. Mit abgewandtem Gesicht stand er an solchen Tagen im Zenit, so dass man die Furche nicht sehen konnte.
Nur alle paar Monate hing er so groß und furchteinflößend wie jetzt über dem Land, zeigte sein böses Gesicht. Und auf seinem Antlitz lag, klein aber gut sichtbar, der Schatten seines Begleiters, der Mond des Mondes, Harlak der Todesbote, der schwarze Weltenfresser.
Das verhieß Mord und Seuchen.
Ajala wandte den Blick ab und ging mit zaghaften Schritten auf den toten Knochenreiter zu. Die Gebeine seiner Rüstung waren rußgeschwärzt und von Blut befleckt, aber die Augen hinter dem Visier leuchteten hell. Etwas Merkwürdiges war mit ihnen, etwas, das über den Tod hinausging.
Ehrfürchtig beugte sich Ajala zu ihm. Sein mächtiger Körper lag reglos im Staub, seine Brust hob sich keinen Fingerbreit, aber was war mit seinen Augen? Hatten die sich nicht gerade bewegt? Es war kaum zu erkennen hinter dem dichten Visier. Etwas wie ein Knistern ging von seinem Körper aus, Ajala hatte es im Rauschen des Windes fast nicht bemerkt. Ein Geräusch, das ihr eine Kälte einflößte, als würde Gletschereis durch ihre Adern gepresst.
Und dann konnte sie ihn riechen, diesen unsäglichen Gestank. Verfaultes Aas und Sumpfgase, Schlangenpilz und gestocktes Blut. Ein Geruch aus der Unterwelt.
Mit zitternden Fingern löste sie die Lederbänder am Helm, klappte vorsichtig das Visier zurück und erstarrte.
2. Kallum
König Kallum von Tagwald, der von seinem Volk der Graue König genannt wurde, blickte aus den hohen Fensteröffnungen des Thronsaals. Das Morgenlicht ließ seine eisgrauen Augen aufleuchten, aber der Zug um seine Mundwinkel sprach von Mattigkeit und Alter. Sein langes, aschgraues Haar fiel ihm in die Stirn, die von trüben Gedanken in Falten gelegt war.
Der Traum der vergangenen Nacht senkte sich wie ein Schleier über das geschäftige Treiben im Saal, Schemen von dunklen Gestalten standen starr zwischen den plappernden Höflingen. Die Traumgespinste wurden deutlicher, der Schleier wurde zu einem Vorhang, der sich vor der Welt der Lebenden schloss.
König Kallum hatte in den letzten Jahren zahlreiche dieser Träume gehabt, genau seit dem Tag, an dem sein Sohn verschwunden war. Er war von der Jagd nicht zurückgekehrt, und schon in der ersten Nacht hatte sich Kallum in seinen schweißnassen Decken hin und her gewälzt.
Damals, vor mehr als zehn Jahren, waren ihm die Traumgesichte wie eine Botschaft vorgekommen, die er nicht entschlüsseln konnte. Jetzt war die Botschaft zu einer zweiten Wirklichkeit geworden, und er konnte noch immer nicht den Sinn erkennen, aber die Dringlichkeit, erneut etwas zu unternehmen, war so stark geworden, dass Kallum kaum noch ruhig auf seinem Thron sitzen konnte, kaum in der Lage war, sein Reich zu führen, sei es auch noch so klein.
Er strich sich über das schwer gefurchte Gesicht und versuchte die Vision abzuschütteln: die dunklen Gestalten mit ihren Augen schwarz wie Teer. Sie sprachen nicht, sie hatten nie gesprochen zu ihm, sie standen nur starr. Ab und an machten sie seltsame Gesten mit ihren knochigen Fingern, als würden sie eine Sprache nutzen, die keiner Worte bedurfte.
Ihre Haut war von einem grünlichen Film überzogen, der wie Algen leuchtete. Sumpfwesen, Geister des Moores vielleicht. Aber weitaus bedrohlicher.
Und da war noch etwas gewesen, in dem Traum der letzten Nacht, eine Frau mit langen roten Haaren und bernsteinfarbenen Augen. Ihr Gesicht hatte eine stille Würde, die sie wie eine Königin wirken ließ.
Hatte er die Frau schon einmal gesehen? Oder war es nicht vielmehr ein Mädchen gewesen? Eine Greisin vielleicht? Ihr Gesicht veränderte sich in dem Traum, als würden die Jahre darüber hinweg fließen. Wasser des Lebens, Wasser des Todes.
Kallum schreckte auf, eine Hand hatte sich auf seine Schulter gelegt. Hauptmann Hargun beugte sich zu ihm und flüsterte ihm ins Ohr.
„Euer Hoheit, Fürst Tarnog wünscht Euch zu sprechen. Soll ich ihn vorlassen?“
Kallum blickte auf, die Schemen waren verschwunden, die Morgensonne schickte ihre Strahlen durch den Raum und ließ die Holzwände leuchten wie Honig. Die Wandteppiche glühten in allen Farbtönen des Waldes und der Erde.
Am Ende des Saals, zwischen dem niederen Adel, stand Tarnog Echsenhand, um ihm den Morgen zu versüßen.
Kallum hätte ihn am liebsten zu seinen Ziegenweiden und Hirsefeldern zurück gejagt, aber sein kleines Reich war auf die Lieferungen des Fürsten angewiesen.
Er nickte dem Hauptmann kurz zu, und dieser winkte Fürst Tarnog heran.
Mit finsterer Miene schritt die Echsenhand zum Thron, sein mächtiger Brustkorb bebte vor unterdrücktem Zorn. Auf dem dunklen Lederharnisch prangte sein Wappen, zwei gelbe Kornähren auf grünem Grund, gekrönt von zwei schwarzen Äxten und einer Fürstenkrone. Ein zugleich lächerliches wie anmaßendes Wappen, wie Kallum fand.
„Majestät“, presste Tarnog zwischen den schmalen Lippen hervor, „es sind schon wieder zehn meiner Männer am Haupttor von Tagwald abgewiesen worden. Das geht gegen jegliche Vereinbarung! Ich fordere, dass sie jederzeit eingelassen werden. Ich verlange es!“
Kallum schaute ihn kühl an, er würde ihn auf eine Antwort warten lassen. Die Hofschranzen tuschelten hinter vorgehaltenen Händen, und Tarnog fing an, sich unter der Verachtung zu winden, die ihm von allen Seiten entgegenschlug.
Tarnog Echsenhand, der Schlächter von Kaltenbach – er hatte nicht nur Ziegen als Untertanen, auch eine Streitmacht von mehr als 200 Männern, gut ausgebildeten Männern. Tarnog sollte man nicht unterschätzen und gerade deshalb war es wichtig, ihn und seine Krieger in die Schranken zu weisen. Seine Echsenhand würde sonst schneller nach der Macht greifen, als es Kallum lieb sein konnte.
Kallum hatte seinen Blick noch immer nicht von Tarnog abgewandt. Wie er schon dort stand, ein Bauer, der das Kriegshandwerk erlernt hatte. Seine hünenhafte Gestalt, sein dichter schwarzer Bart, das grobschlächtige Gesicht. Das eine Auge war heller als das andere, fast milchig, und die Pupille war starr von dem Hieb, der sein Gesicht beinah gespalten hätte. Eine lange und breite Narbe verunstaltete sein ohnehin schon hässliches Antlitz, und sein kahler Schädel war nur verschont geblieben, weil er ihn mit seinem Unterarm geschützt hatte. In diesem Kampf hatte er seinen Kopf gerettet, aber seine Schwerthand verloren.
Der Kampf, der Tarnog verstümmelt hatte, lag Jahrzehnte zurück, er musste noch ein Jüngling gewesen sein, aber es gab Gerüchte, Legenden fast, über diesen Zweikampf.
Einmal hieß es, es sei ein Bär gewesen, der ihn so zugerichtet hätte, ein anderes Mal, Tarnog sei an einen Berserker aus dem Eisland geraten. Selbst ein Tatzelwurm wurde von den Gassenjungen verantwortlich gemacht.
Aber gleich welche Legende erzählt wurde, Höhepunkt war immer, wie Fürst Tarnog ihm sein Schwert mit der Linken durch die Kehle gezogen und danach das Herz und die Leber des Gegners gegessen hätte.
Das Blut strömte noch immer aus seinem Armstumpf, nachdem er sich mit letzter Kraft in ein abgelegenes Dorf geschleppt hatte. Dort war er von einer alten Frau gesund gepflegt worden.
Woher er später die Echsenhand bekam, eine schuppige Klaue, die an seinem mächtigen Körper wie ein Spielzeug hing, das war Inhalt anderer Sagen. Ein mächtiger Hexenmeister hätte sie ihm angezaubert, eine abtrünnige Schamanin wäre verantwortlich dafür.
Tatsache blieb, Fürst Tarnog war eine Bestie, seine Klaue schien ein Eigenleben zu führen, und zahllose Widersacher hatten sie schon an ihren Kehlen gespürt. Vielen hatte er das Leben genommen.
König Kallum räusperte sich und schaute wieder zur Fensteröffnung hinaus. Die Morgensonne war jetzt gänzlich über die Holzschindeln der Dächer gekrochen und die Blütenpollen der Herbstblumen tanzten in ihrem Licht.
Kallum kniff die Lider zusammen und sprach dann wie beiläufig zu Tarnog, ohne ihn dabei anzusehen.
„Ihr solltet noch einmal die Abmachung lesen, die unsere Väter beschlossen haben, wenn Ihr des Lesens mächtig seid. Wenn nicht – ich bin mir sicher, dass Ihr dafür einen Diener habt, oder zumindest auftreiben könnt.“
Kallum blickte ihn jetzt direkt an.
„Aber ich kann Euch den fraglichen Abschnitt gerne zusammenfassen. Er besagt, dass in Zeiten der Gefahr der König von Tagwald berechtigt ist, den Zugang von Kämpfern zu beschränken.“
Fürst Tarnog spuckte auf den Boden, ein Raunen ging durch die Reihen der Höflinge.
„Das soll ich Euch einfach so abkaufen? Ihr biegt Euch doch die Worte zurecht, wie sie Euch passen! Es herrscht keine Gefahr in den Auen von Tagwald! Von ein paar Wölfen abgesehen.“
„Das ist eine Frage der Sichtweise“, erwiderte Kallum. „Man hört dieser Tage von Knochenreitern.“
Tarnog schnaufte und sein dunkles, unversehrtes Auge blitzte vor Zorn.
„Ammenmärchen! Ich werde das nicht einfach hinnehmen. Ich werde Euch die Lieferungen einschränken, so wie Ihr meinen Männern den Zugang beschränkt!“
Kallum winkte müde ab.
„An diese Abmachungen seid Ihr allerdings genauso gebunden, wie an die unserer Väter. Oder wollt Ihr wortbrüchig werden? Das wird Euren Ruf nicht mehren, befürchte ich.“
Tarnog machte eine unwirsche Geste und stürmte dann zum Saal hinaus. Die Höflinge fingen wieder an zu tuscheln und Kallum verzog sein Gesicht zu einem freudlosen Lächeln.
Nachdem die Echsenhand wutentbrannt abgezogen war, beugte sich Hauptmann Hargun erneut zu Kallum.
„Euer Hoheit, es gibt noch etwas, das Eurer Aufmerksamkeit bedarf. Die große Hecke muss überprüft werden.“
Kallum schaute gedankenverloren auf seinen Hofstaat. Nichts als Bauern in Roben! Und selbst die Roben nur aus Leinen mit ein wenig Zierrat. Kein Vergleich zu der Hauptstadt, nicht im Entferntesten die Pracht von Eisenfurt. Aber was sollte man erwarten? In der Hauptstadt lebten zehnmal mehr Untertanen als in seinen gesamten Ländereien.
„Majestät, es ist dringend. Die große Hecke wurde beschädigt. Vielleicht ein nächtlicher Angriff, vielleicht sogar das Werk der Echsenhand!“
Kallum blickte zu Hargun auf, dann erhob er sich von seinem Thron.
„Das ist unmöglich, die große Hecke kann nicht beschädigt werden.“
Hargun wiegte den Kopf hin und her.
„Aber doch ist es so. Ein Feuer hat eine Schneise hinein gebrannt.“
Kallum schaute ihn fassungslos an, dann straffte er sich.
„Es fällt mir schwer, das zu glauben. Denn wie Ihr wisst, kann die Hecke nicht Feuer fangen. Aber ich werde es mir selbst ansehen.“
Hargun nickte beflissen, sein grobschlächtiger Schädel wackelte wie bei einer Kinderpuppe. Und genau wie bei einer Puppe standen ihm die braunen Haare struppig nach allen Seiten ab. Unbeholfen strich er sich durch den kurzen aber zerzausten Bart.
„Es gibt sicherlich eine andere Erklärung dafür, aber so haben es die Wachen gemeldet.“
„Dann lasst uns gehen.“
Die große Hecke spannte sich mächtig und unüberwindlich um das ganze Königsland von Tagwald. Fast ein Jahrhundert alt, mehr als dreißig Fuß hoch und zehn Fuß breit lag sie vor Kallum, der umständlich von seinem Rappen absetzte.
Hargun an seiner Seite schritt er zum Aufstieg des Wachturms, der sich wie ein dickbauchiger Baum in die Hecke schmiegte.
Kallums Urgroßvater hatte sie angelegt, nach den Eisenkriegen, als Schutz vor den Kriegern des Nordens. Und wohl auch als Schutz vor dem Urgroßvater der Echsenhand.
Jahrzehntelang war das Dolchkraut nun gewachsen und im Dickicht der Hecke war kein Durchkommen, nicht einmal für ein Tier.
Das Gestrüpp war so dicht, dass von der anderen Seite kein Licht durchschien, und die Dornen des Gewächses waren handspannenlang und scharf wie Schwertschneiden.
Auf den Zweigen lag eine gräuliche Ausdünstung, die das Gestrüpp Tag und Nacht ausschwitzte und die das Holz unbrennbar machte. Zudem war der dünne Film giftig, es war nicht ratsam, die Dornen zu berühren. Zum Beispiel wenn man Feuer legen wollte.
Deswegen bezweifelte Kallum, dass die Beschädigungen von einem Brand stammen sollten.
Vorsichtig kletterten er und Hargun zur Plattform des Turms empor. Eine verschlafene Wache begrüßte sie erst nachlässig, nahm aber sofort Haltung an, als sie bemerkte, wer da auf den Turm gekommen war.
„Hier, Majestät, eindeutig von einem Feuer“, sagte Hargun und deutete hinunter.
Kallum beugte sich über die Brüstung und schrak zurück. So etwas hatte er zu seinen Lebzeiten noch nicht gesehen. Eine zehn Fuß breite Schneise war bis in die Mitte der Hecke gebrannt, die restlichen Zweige hingen verkohlt und leblos unter dem Wachturm.
Hargun beugte sich nun ebenfalls über die Brüstung.
„Die Wachen haben versucht zu löschen, aber die Flammen loderten dadurch umso höher! Ich kann mir das nicht erklären, es sei denn ...“
Kallum packte ihn an der Schulter.
„Es sei denn was? Sprecht schon!“
Hargun schüttelte den Kopf, über seinem breiten Nasenrücken zeigten sich zwei scharfe Falten.
„Tatzelwurm-Öl! Es lässt sich mit Wasser nicht löschen.“
Kallum lachte ungläubig auf.
„Das sind doch Legenden. Solche zaubermächtigen Essenzen gibt es nicht, hat es nie gegeben.“
Hargun schüttelte erneut den Kopf und deutete auf die verkohlte Schneise.
„Aber dies hier ist doch eine Tatsache, Majestät. Es hätte unseren Schutz vollständig zerstören können. Nur gut, dass das Dolchkraut mehr von der Ausdünstung ausgestoßen hat, als die Flammen sich durch die Hecke fraßen. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ...“
Kallum nickte mit verbissenen Lippen.
„Ja, da habt Ihr recht. Aber wer, bei Feidris, hat das Feuer gelegt?“
„Die Wachen haben nichts gesehen, erst der Rauch hat sie aufmerken lassen.“
„Dann solltet Ihr mehr Wachen aufstellen … und in der Nacht mehr Fackeln!“
Hargun zog die Schultern hoch und breitete die Hände aus.
„Das ist natürlich alles schon veranlasst. Ab dem heutigen Abend werden die Wachen verdoppelt sein.“
Auf dem Weg zurück zur Thronhalle ließ König Kallum seinen Blick über das Land schweifen. Hirsefelder wogten sanft im Herbstwind, Ziegen und Schafe weideten auf den noch grünen Wiesen, vereinzelte Hütten und Höfe duckten sich in das Hügelland und in der Ferne war die kleine Stadt zu sehen, Tagwald, Sitz seiner Ahnen, die einzige größere Ansiedlung seines kleinen Reiches.
Die Häuser der Stadt waren sämtlich aus Holz, meist einstöckig, nur die Händler und Handwerker hatten mehrstöckige Bauten, selbst die Thronhalle am Marktplatz ragte kaum über die anderen Gebäude hinaus.
Als sie durch die Straßen ritten fiel ihm wieder die Schönheit des Ortes auf, die reichen Schnitzereien an Türpfosten und Giebeln, die Szenen der Göttersagen zeigten. Maris Höllensturz, der Kampf des Märgaug mit dem Tatzelwurm, Gaulits Irrfahrt auf dem Silbermeer.
Und doch war die Stimmung gedrückt, seit die Gerüchte aufgekommen waren, Knochenreiter würden aus dem Osten heranziehen.
Kallum spuckte aus und gab seinem Rappen die Sporen. Noch so eine Legende, Knochenreiter, unbesiegbare Krieger, geboren in der Unterwelt. Was sich die Leute am Marktplatz eben so erzählten, wenn der Tag lang war.
Er jedenfalls hatte noch keinen von ihnen gesehen, nicht einmal auf einer Pergamentrolle. Und er hatte einen großen Büchersaal mit Berichten aus aller Herren Länder.
Als sie das königliche Langhaus betraten, wartete der Hofzauberer Jundigol Windhauch schon im Thronsaal auf sie.
Mit weit aufgerissenen Augen und herabgezogenen Mundwinkeln kam er auf sie zugestürzt. Sein kurzes, weißes Haar war von kahlen Stellen durchzogen und sein dünner Ziegenbart sträubte sich in die Luft. Wie ein dünnes, kleines Wiesel fegte er über den steinernen Boden des Saals.
Sein ganzes Gebaren ließ ihn halb wahnsinnig wirken und Kallum nahm an, dass er wieder einmal von dem Dolchsaft getrunken hatte, einem stark verdünnten Gebräu der Ausdünstung der Hecke.
In winzigen Mengen brachte das Gift lebhafte Wahrträume, ohne den Nutzer zu töten, aber man sollte es nicht übertreiben. Und Kallum war nicht sicher, ob der Zauberer diese Vorsicht walten ließ.
Jundigol Windhauch murmelte etwas vor sich hin, das wie eine Beschwörungsformel klang, aber als König Kallum sich auf den Thron gesetzt hatte, kniete er nieder und sein Blick klarte sich auf.
„Mein Herrscher, großer König von Tagwald, ich bin gekommen …“
Kallum schnitt ihm mit einer unwirschen Geste das Wort ab.
„Ihr wisst, dass diese übertriebene Ehrerbietung nicht mein Gefallen findet. Kommt zur Sache, es warten wichtige Dinge auf mich.“
„Oh, selbstverständlich, Eure Hoheit. Es ist nur so, ich bin noch ganz gebannt von meinen alchemistischen Versuchen der letzten Nacht. Ich habe Euch doch erzählt, dass ich Schattenschlick besorgen konnte. Ganz wenig nur, aber doch genug für ein unermessliches Ereignis in meinem Leben.“
Kallum nickte knapp und der Zauberer erhob sich unter Stöhnen. Jundigol war viel älter als er selbst, obwohl Kallum mehr als fünfzig Jahre zählte. Er hatte schon unter seinem Vater gedient und Kallum fragte sich, wie ein Mann so alt werden konnte.
„Majestät, diese Zutat ist seltener als Gold, seltener noch als Mondeisen. In ganz Kalandris habe ich noch keinen Schattenschlick gefunden, und ich suche schon sehr lange danach. Sogar der Händler, von dem ich es kaufte, für eine Unsumme nebenbei gesagt, sogar der Händler wusste nichts über seine Herkunft. Der Schattenschlick härtet an der Luft schnell aus, wie Ihr sicher wisst. Und wie Ihr ebenfalls wissen werdet, kann man in jenem Moment ein Bild auf seine Oberfläche bannen, von der Umgebung und auch von den Menschen, die ihm gegenüberstehen! Höchst bemerkenswert, wenn Ihr mich fragt!“
„Ja, das ist mir alles bekannt. Glaubt Ihr nicht, dass Ihr gerade meine Zeit verschwendet?“
Jundigol Windhauch schaute ihn erschrocken an.
„Nein, nein, Eure Hoheit, ich hoffe doch nicht. Weit davon entfernt! Ich habe den Schattenschlick nämlich letzte Nacht in einem unbeleuchteten Raum aus seinem Behältnis genommen und ihn mit Smaragdstaub und Hirschhornpulver vermischt. Dann habe ich einige Rituale durchgeführt. Aber ich will Euch nicht mit Einzelheiten langweilen.“
Kallum lächelte abfällig.
„Das will ich hoffen!“
Jundigols Züge zeigten Verwunderung, aber er ließ sich nicht beirren.
„Es ist ein Bild auf seiner Oberfläche entstanden, trotz der absoluten Dunkelheit. Kaum möglich, aber so ist es geschehen. Ihr solltet Euch den ausgehärteten Schattenstein anschauen!“
Der Zauberer zog aus seinem Umhang einen wie poliert glänzenden, flachen Stein von tiefem Schwarz und etwa so groß wie ein Handteller.
Kallum nahm ihn entgegen und sein Inneres zog sich zusammen, eine kalte Woge aus Unbehagen wurde durch seinen Körper gespült. Kam das von dem Schattenstein oder von dem Bild auf ihm?
Auf seiner Oberfläche waren die grauen Schemen zweier Menschen zu sehen. Der eine war ganz ohne Zweifel sein verschwundener Sohn, Prinz Jaris, wenn auch gealtert. Sicher schon dreißig Jahre zählte er auf dem Abbild. Kallum wollte gar nicht daran denken, was das bedeuten konnte, denn enttäuschte Hoffnung war immer schon eine glühende Klinge gewesen. Das andere Schemen war die Frau aus seinen Träumen und wieder war ihr Gesicht leicht verwischt.
Wie war das möglich? Es wirkte fast so, als hätten sich seine Klarträume des Nachts von ihm gelöst, um in den Räumen umherzuirren, bis sie schließlich in diesem Schattenstein Ruhe gefunden hatten.
Wieder betrachte er das undeutliche Bild der Frau auf der schwarzen Oberfläche. Ich muss diese Frau finden, dachte er, das Leben meines Sohnes könnte davon abhängen, vielleicht sogar das Überleben meines Reiches. Woher der letzte Gedanke stammte war ihm nicht ganz klar.
Angespannt sah er den Hofzauberer an.
„Schaut her, sieht diese Frau nicht ein wenig aus wie die Königin von Eisenfurt?“
Jundigol betrachtete mit schwachsichtigem Blinzeln das Bild.
„Ja, könnte sein, ich bin mir nicht sicher. Es ist bald sieben Jahre her, dass ich am Hof in der Hauptstadt war. Aber eine Ähnlichkeit glaube ich erkennen zu können. Ja, doch, das könnte gut die Königin sein. Vielleicht ein wenig hager geworden … um die Nase herum. Doch, ich bin mir sicher, eigentlich schaut sie genauso aus wie die Königin. Möglich, dass es ein Jugendbildnis ist.“
Kallum versank in ein dumpfes Brüten, erst nach Minuten hob er wieder den Kopf und nickte Hargun zu.
„Also gut, ich werde nach Eisenfurt reisen. Ihr müsst mir den Zweigharnisch anlegen!“
Voller Schrecken starrte der Hauptmann Kallum an, ein Keuchen drang aus seiner Kehle.
„Majestät, das wollt Ihr nicht wirklich tun! Die Rüstung hat Euch schon einmal fast umgebracht! Sie wird Euch endgültig vernichten! Ihr seid kein Jüngling mehr.“
Kallum streckte unwillkürlich die Hand zu seinen Schulterblättern und rieb die kleine, wulstige Erhebung auf der Haut zwischen ihnen. Dort war der narbige Zugang, der den Spross des Zweigharnischs aufnahm, der tief in sein Inneres dringen würde, in dem Moment, wo die Rüstung von ihm Besitz ergriff.
[...]